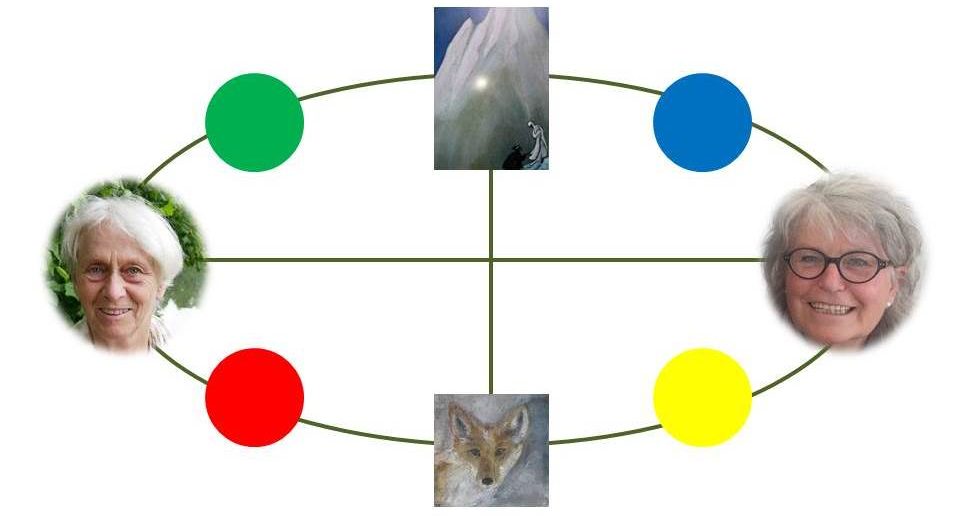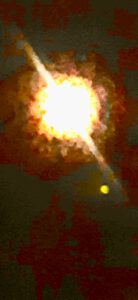In der letzten Zeit beobachte ich eine interessante Entwicklung auf dem Buchmarkt. Es erscheinen zunehmend Bücher, in denen neueste wissenschaftliche Erkenntnisse verbunden werden mit einer indigenen und/oder schamanischen Perspektive auf die Welt.
Das Buch von Robin Kimmerer, „Geflochtenes Süßgras“, habe ich bereits in einem Blog vorgestellt. In dem Buch „Das Rätsel der Schamanin“ entschlüsseln ein Archäologe und ein Historiker das Rätsel um ein weibliches Skelett mit reichen Grabbeigaben, das in Bad Dürrenberg bei Halle gefunden wurde. Vor 9000 Jahren wurde der Körper beigesetzt, in einer Epoche großer Umwälzungen, die letztendlich in unsere heutige Gesellschaft mündeten.
Harald Meller und Kai Michel bemühen sämtliche verfügbaren Methoden der Wissenschaft und beschreiben auf spannende Art und Weise ihre Erkenntnisse, bis sie schlussendlich gesichert feststellen können: diese Frau muss tatsächlich eine Schamanin, eine Heilerin, gewesen sein, deren Grab noch Jahrhunderte später von Menschen aufgesucht wurde.
Die Untersuchungen führen uns die gesellschaftlichen Entwicklungen von der animistischen Weltsicht, die uns immer noch in den Genen steckt, über die Professionalisierung des schamanischen Heilens bis zu den heutigen Weltreligionen vor Augen. Und lassen Pfade in eine Zukunft deutlich werden, in der die Spaltung zwischen unserer ererbten Natur und den Dilemmata der modernen Gesellschaft überwunden werden kann.