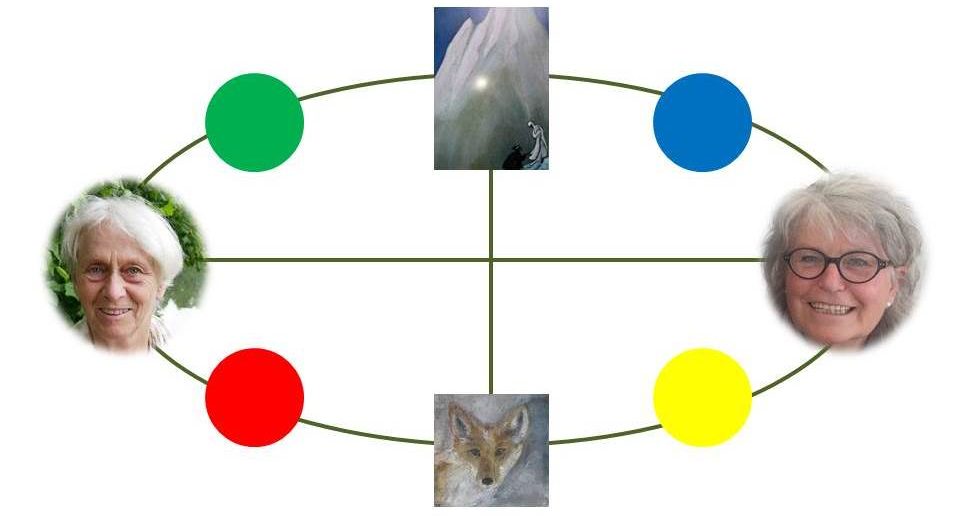Wir haben als Kinder alle Ferien zusammen verbracht, eine Bande gegründet, uns gegen die Eltern verbündet, stundenlang Mensch-ärgere-dich-nicht gespielt. Dann kamen Zeiten, in denen wir wenig miteinander zu tun hatten. Sie heiratete früh und bekam Kinder, ich studierte. Als ich auch Kinder hatte, fanden wir wieder zueinander.
Wir feierten 65. und 70. Geburtstage, und sie zog zu ihrem Partner ans Meer. Wir freuten uns auf meine Besuche in ihrer neuen Heimat, auf gemeinsame Tage an der See, in denen wir in Kindheitserinnerungen schwelgen würden.
Es dauerte eine Weile, bevor ich sie besuchen konnte – und dann war plötzlich alles anders. Sie war zur „Frau an seiner Seite“ geworden. An Geschichten von früher erinnerte sie sich nicht mehr. Zunächst dachte ich, das muss ich akzeptieren. Für sie steht ihre Partnerschaft jetzt an erster Stelle.
Doch dann fiel mir ihr unsicherer Gang auf, das ständige Stolpern, die zusammengekniffenen Augen, die gebeugte Haltung. Früher eine lebhafte Erzählerin, die von Geschichten nur so übersprudelte, war sie still geworden, hörte zu, warf nur ab und zu eine Bemerkung ein.
Es ist nicht möglich, mit ihr über diese Veränderungen zu sprechen. Sie wehrt den kleinsten Hinweis ab. Nein, sie stolpert nicht. Nein, sie ist gesund… Ich bin ratlos, traurig, nehme in Gedanken Abschied von ihr und unserer gemeinsamen Zeit. Ein Lieblingsmensch kommt mir abhanden…